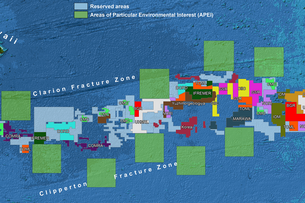Zwischen Werden und Sein
Streifzüge durch die Stadt Essen
by
Pascal Bovée
Themen
Residenzen
Als Writer in Residence sitzt man natürlich nicht bloß auf dem rot gepolsterten Sofa im PACT-Foyer, trinkt in aller Ruhe Limo und kritzelt in sein Notizbuch. Man sitzt auch auf dem blauen Polster in der Straßenbahn, darf offiziell nichts trinken und tippt auf seinem Smartphone. Gern in der Kulturlinie 107, denn die bringt einen von Zollverein ins Essener Zentrum, zu manchen Uhrzeiten sogar ein Stück weiter bis zur Endstation Bredeneyim Süden der Stadt. Bredeneyist heute mein Ziel, denn ich möchte herausfinden, wieso die Kulturlinie gerade dort endet. Dafür muss ich allerdings zuvor den Fahrplan-Ticker entschlüsseln. In einer für Stenographie gewohnte Fahrgäste wie mich zwar zu langen, aber nicht mysteriösen Botschaft berichtet er von Entlastung des Fahrdienst Strab. – Linie 107 und verspricht Ersatzbusse am Fahrbahnrand. Also dann Bus, denke ich und weil auf der Anzeige der Kulturlinie ein sofort leuchtet, eile ich über die Straße zum Fahrbahnrand. Da höre ich in meinem Rücken die Tram wie gewohnt am Bahnsteig Halt machen. Kein Problem, alles zurückgespult, nochmal zur Bahn, doch ich muss an der Straße kurz warten, weil ein Bus vorbeifährt. Weiter vorne hält er, Ersatzverkehr 107lese ich auf seiner Anzeige, als ich mitten auf der Straße stehe. Meine Datenverarbeitung ist damit für wenige Sekunden überfordert, hin und her gerissen zwischen Bus oder Bahn, Kultur oder Linie, bin ich auf der Straße vor dem roten Förderturm erstarrt, überlege wohin – und verpasse auf diese Weise Bus und Bahn.
Ein Anzug tragender, älterer Herr auf dem Bahnsteig hat sich scheinbar lieber eine Zigarre angesteckt als mitzufahren. Er schaut mich allwissend an. »Passiert«, sagt er. »Mehr Zeit hätten Sie gebraucht.« Ich nicke. Der Herr schaut auf die Uhr. Er lächelt so freundlich wie ein Schuhverkäufer und trägt auch so gewählte Schuhe, dass ich die nächsten Worte aus seinem Mund zuerst nicht ihm zuordne, doch sonst ist niemand an der Haltestelle. »Riesenscheiße.« Der Mann nimmt einen Zug von seiner Zigarre und atmet aus. »Auf Deutsch gesagt.»
Für mich als PACT-Kolumnist ist es natürlich ein Glücksfall, auf diese Weise eine Bahn zu verpassen. Ich klappe, als ich in der folgenden Tram sitze, mein Notizbuch auf, und schreibe als Stichwort Riesensch. Strab. 107 – grauer Herr hinein, da teilt mir eine Durchsage des Fahrers mit, dass er entgegen meiner Interpretation des Tramtickers nur bis zum Hauptbahnhof fahren und mich nicht bis zur Endhalte bringen wird. Mich widerwillig hinausbewegend in die Haltezone Hauptbahnhof und ihr Unterwasserblau, driften meine Gedanken ab, schwimmen vor den maritimen Leuchtröhren des Bahntunnels vor sich hin. Es ist ein Schwebezustand, wie er sich unter Wasser ganz natürlich einstellt, man befindet sich hier weder an der Oberfläche noch auf dem Grund, man ist dazwischen.
In diesen Situationen begegne ich immer Julian. Da erscheint er auch schon auf dem U-Bahn-Monitor und trägt die gleiche beige Jacke wie ich. Julian können Sie nicht kennen, er ist mein Alter Ego. »Tja, so ist das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hier«, sagt er und grinst. »Man muss Umsteigezeit einplanen.« Sie merken schon, Julian weiß es besser. Mich stört der ungeplante Umstieg nicht so sehr wegen der Zeitverzögerung, sondern, so wird Julian gleich ebenfalls richtig analysieren, vor allem wegen dieses Gefühls: Dazwischenzu sein. Ich meine, so ist das doch beim Umsteigen: Jedes Mal ist man dazwischen. Zwischen zwei Orten, zwei Verkehrslinien, zwischen zwei Tätigkeiten. »Das ist nicht nur beim Umsteigen so«, präzisiert Julian. »Das ist generell hierin Essenso. Essen ist dazwischen.«
Falls Sie auch ein Alter Ego haben, wissen Sie wahrscheinlich so gut wie ich: Man darf es nicht für voll nehmen. Deshalb gebe ich nicht viel auf Julians Theorien über Essen. Doch Julian, das ist typisch für ihn, versucht sie gleich mit – auf mich oft zufällig wirkenden – Fakten zu untermauern.
»Essen liegt zwischen Freiburg und Hamburg.«
Ja. Das ist irgendwie richtig. Was soll ich da entgegnen?
Und nicht nur der Himmelsrichtung nach hat Julian recht, sondern auch statistisch betrachtet, wie er ergänzt. »Vergleiche die Einwohnerzahlen.« Das ist wirklich Julian. Ihn interessieren an einer Stadt so seltsame Sachen wie Einwohnerzahlen. Dabei sagt die bloße Anzahl ja nun wirklich nichts über einen Ort aus. Viel wichtiger ist doch wohl, wer ihn bewohnt. Oder was er oder sie so macht. Als ich gerade den Mund öffne, um zum Widersprechen Luft zu holen, taucht eine weitere submarine Kulturlinie auf. Auf der Anzeigetafel leuchtet Bredeney. Wir steigen ein.
Nachdem wir Rüttenscheid unterquert haben, kriecht die gelbe Tram wie eine Raupe am Kruppwald entlang den Hügel hinauf und endet schließlich in Bredeney. Wir steigen aus, wo laut Fahrplan die Essener Kultur endet. Ich bin irritiert. Niemanden sonst, der hier aussteigt, scheint das weiter zu interessieren, niemand geht seiner Wege oder macht sich auf die Suche nach den letzten Spuren der städtischen Kultur. Alle warten nochmals an der Haltestelle. Ich schaue Julian an. »Dazwischen«, grinst er überlegen. Bredeney, erfahre ich, ist für die Mitfahrenden nur eine Zwischenstation. Denn die Tram endet zwar hier, aber man wartet nun zusammen auf den Bus, der einen weiterbefördert bis nach Essen-Werden. »Na und?«, meine ich. »Eben nochmal umsteigen.« Trotzdem beschleicht mich im Bus, der in einem wahnsinnigen Tempo durch die Kurven am Seeufer treibt und meinen Magen in Unruhe versetzt, ein mulmiges Gefühl. Worauf will Julian hinaus mit dieser Dazwischensache?
Am Werdener Markt steigen wir aus und erstmal führt mein Alter Ego mich zum Kiosk gegenüber der Folkwang Universität. Hier hat Julian studiert. Zwischen den Proben treffen sich die Musiker mit ihren Instrumentenkoffern auf dem Rücken bei Roberto, der den Kiosk betreibt. Gerade schneidet er Tomaten für ein Caprese-Sandwich. Mit dem Gemüse in der Hand gestikuliert er schulterzuckend und erklärt einer Frau – seiner Frau, vermute ich – die er auf dem Telefon anschaut, das er vor sich im Geschirrregal abgestellt hat, dass er gerade viel zu tun habe. Nebenher bedient er eine asiatisch aussehende Studentin, die noch »questo und questo« aus dem Schokoladenregal bestellt. Hinter ihr reihen sich ihre Kommilitonen auf, die gerade Chorpause haben und noch weiterträllern. An den Schokoriegeln hängt ein Metallschild, auf dem Bud Spencer und Terence Hill abgebildet sind. Auch sie bestellen gerade, ebenfalls Schokoriegel, aber nicht auf Italienisch, sondern mit dieser Geste mit den zwei Fingern, die für sie immer noch bedeutet, dass Raider jetzt Twix heißt. Roberto weiß gar nicht, wen er zuerst bedienen soll, aber seine Frau interessiert das nicht, sie redet einfach lauter, ihre Stimme kommt verzerrt aus dem Smartphonelautsprecher. Roberto ist erst seit ein paar Tagen aus Italien zurück, erzählt er mir und hängt nun irgendwie noch ziemlich zwischen hier und da. »Sind wir deswegen hier?«, frage ich Julian.Ich sage ihm, der valide Daten so liebt, dass wir auf diese Weise nicht empirisch belegen können, dass Essen irgendwas mit Dazwischensein zu tun haben soll. Er schüttelt den Kopf. »Hier sind wir, weil der Espresso gut ist.« Roberto wundert es zwar, dass ich statt eines Doppio zwei einzelne zum Hier-Trinken bestelle, aber er zuckt dann nur wieder die Schultern und setzt sich weiter mit seiner Frau auseinander. Gegenüber, durch den gelben Torbogen der Hochschule, fährt ein Transporter der Firma Brehm Bodenbeläge. Da zieht mich Julian am Ärmel, weil wir angeblich weitermüssen. Für unterwegs möchte er allerdings auch noch einen Cappuccino haben. Roberto macht auch den schulterzuckend zweimal für mich fertig, dann gehen wir runter zur Insel.
Der Brehm, ein Wasser umspielter Saum, wie eine Infotafel aufklärt, liegt tatsächlich ziemlich dazwischen. Zwischen der beschaulichen Werdener Altstadt und der lauten Bundesstraße 224, die ins Essener Zentrum führt. Vor allem aber zwischen zwei Armen der Ruhr. Wer die kleine Insel betritt, wird zuerst darauf hingewiesen, dass es hier auch pico bellogeht. An sich kein Problem für mich, ich werfe die Cappuccino-Becher in den Mülleimer, doch habe ich etwas Angst vor dem Unfugknöllchen, das mir der kleine Junge in Latzhose auf dem Verbotsschild androht. Was wenn er meine Recherche auf der Dazwischen-Insel für Unfug hält? Julian drängt mich weiterzugehen.
Der Brehm ist ein ovaler Park mit großer Rasenfläche und Spielplätzen in der Mitte und vielen Bäumen am Ufer. Wir spazieren, sinnieren und stellen uns schließlich mitten auf die Insel. Genau zwischen den beiden romanischen Torbögen, die Maria Nordman 1984 hier aufgestellt hat, stehen wir, als die Sonne untergeht und diesen Moment kann sich mein Alter Ego nicht entgehen lassen – es setzt zum Besserwissen an. Ausgebreitet legt Julian mir seine Theorien über Städte dar, während ich zu frieren beginne.
»Freiburg ist eine Stadt, die noch etwas Gemütliches hat«, sagt er. »Eine Großsstadt, aber eine, die dabei noch angenehm überschaubar ist. Mit hübschen Weinbergen, sozusagen als grünem Rahmen.«
»Aha.« Keine Ahnung, wieso es ihm gerade Freiburg so angetan hat.
»Hamburg dagegen ist eine City, eine Hafenmetropole, in der das Leben pulsiert. Ein Ort, an dem Schiffe aus aller Welt ankommen und die Kulturen sich begegnen.«
Hat er das von den Webseiten des Stadtmarketings? Ich betrachte die Holzpferde auf dem Brehm-Spielplatz. Sie ziehen ein Kohleschiff, wie es vor ziemlich langer Zeit hier mal unterwegs gewesen sein soll.
Julian kennt kein Pardon. »Die Frage ist doch: Wenn Freiburg die gemütliche Großstadt mit den Fahrrädern ist und Hamburg die pulsierende mit den Ozeanriesen – was ist dann Essen?«
Ich zucke die Schultern wie Roberto, wenn er Espresso für Unsichtbare macht.
»Essen ist die klassische Dazwischenstadt. Der Größe nach – und der Bedeutung nach. Hier fühlstdu dich dementsprechend auch immer, als wärst du dazwischen.«
Naja, ich habe schon gemerkt, dass manche hier gerne bedeutender wären. Oder entspannter, grüner. Deswegen immer diese Hauptstadtambitionen. Die Vergleiche. Offenbar kann die Stadt nicht einfach sein, was sie ist.
»Eine Dazwischenstadt ist wie Umsteigen«, sagt Julian. »Du fühlst dich wie beim Warten zwischen Tram und Bus. Dieses Dazwischengefühl, das hat ein Azubi kurz nach der Prüfung, der keine Stelle in Aussicht hat. Oder eine Studentin nach dem Bachelor. Und vor dem Vielleicht-Master. Das Gefühl hast du nach einer frischen Trennung. Nach der es irgendwie weitergeht, aber zuhause wartet erstmal doch nur Facebook auf dich. Du weißt für eine seltsame Dazwischenzeit nicht richtig, wer du bist. Du verpasst dir erstmal eine neue Frisur, um dich anders zu fühlen.«
Frisur? »Eigentlich fühle ich mich hier ganz wohl«, sage ich. »Kann an der Ruhr super denken.«
»Dazu sind wir ja auch auf dem Brehm«, schulmeistert Julian. »Aber der ist eine Insel. Ganz Werden ist eigentlich eine Insel – und in Wirklichkeit nicht Essen.«
»Oh. Ich dachte, Essen wäre irgendwie überall Essen.«
Julian ist genervt von meiner langen Leitung und versucht es jetzt wieder mit Freiburg und Hamburg. »Wenn du in Freiburg von A nach B willst, dann stört das nicht. Du nimmst das Fahrrad. So bist du immer an der frischen Luft, machst Sport in der – reichlich vorhandenen – Sonne und bist schnell am Ziel. Als Fahrradfahrer kommst du in so einer überschaubaren Großstadt super zurecht.«
In Hamburg wussten manche schon in den Neunzigern nicht, wieso sie das so hassten. Julian hat damals auch da gewohnt. Ich fuhr Fahrrad, alleine und fand es supercool.
»In Hamburg stören A und B nicht«, doziert mein Alter Ego weiter. »Du bist nämlich an beiden Orten gern. Aber wenn du doch mal von A nach B willst und es mit dem Fahrrad zu weit sein sollte, nimmst du einfach eine Bahn. Die kommt fast immer in zwei oder drei Minuten. Mit Bus und Bahn kommst du in einer echten City super zurecht.« Bevor ich zweifelnd die Stirn runzeln kann, schiebt er hinterher: »In richtig modernen Cities, Kopenhagen zum Beispiel, kannst du das Fahrrad auch problemlos in der Tram mitnehmen.« Julian hat natürlich ein ultraleichtes Rennrad. Ich weiß jetzt, worauf er hinaus will. Er denkt, wenn er auf den Essener Verkehrsbetrieben rumhackt, schlucke ich seine komische Dazwischentheorie. Beim ÖPNV-Bashing stimmt schließlich jeder mit ein, auch ich. Riesenscheiße. Da habe ich eine Idee.
»Los, wir schauen mal, ob der Bus gerade kommt«, sage ich.
Natürlich kommt er jetzt nicht. Inzwischen ist es Abend und mit dem 10-Minuten-Takt ist es vorbei. In Julians Brillengläsern spiegelt sich im Dunkeln schon die Glühbirnenschrift Werden, die gegenüber der Haltestelle hängt.Sie verschwimmt mit den Rücklichtern der Autos auf der Ruhrbrücke. Immer noch ziemlich viele sind es, im Wartehäuschen atmen wir Abgase ein. Mein Alter Ego sieht jetzt echt genervt aus. In 22 Minuten ko mmt der nächste Bus. »Prima«, sage ich. »Dann ist dazwischen ist noch Zeit für einen Espresso.«
Julian ist leicht zu bestechen. Auf dem Rückweg, in den scharfen Kurven am Seeufer, fängt er zwar wieder von Statistik an, aber das lächle ich weg. Ich weiß, dass er vor allem diejenigen Statistiken liebt, die schick frisiert sind wie die Blogger, mit denen er jetzt immer rumhängt. Julian, das muss ich noch ergänzen, lebt seit kurzem in Berlin. Genauer gesagt zwischen Berlin und Paris, in einer Fernbeziehung. Er nennt sich jetzt übrigensJean, trägt Undercut und ist selbst ebenfalls Blogger geworden. Postet melancholische Lyrik übers Dazwischensein. Anscheinend gibt es das manchmal auch in anderen Städten.